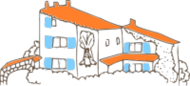Predigt für den 26. September 2010 im Temple von Vallon
(« Gottesdienst über den evangelischen Gottesdienst » zur Finissage der Austellung Uwe Appold)
Evangelium: Lukas 13, 10 bis 17
Predigt: Apostelgeschichte 2, 42 - 47
Lieder: Arc-en-Ciel 84, 1-3-4 ; 521, 1-4-8-9 ; 631, 1-2-3
Spontane Antwortverse: (AEC) 118, 1 ; 428, 4 ; 475, 2 ; 81, 8 ; 862 ; 875 ; 151, 1, 138, 2
Das Evangelium zum heutigen Sonntag berichtet von einem Synagogengottesdienst, der reichlich gestört wurde. Wenn wir freilich genau hinhören, können wir entdecken, daß der Text in Wahrheit von einem der Ziele allen Gottesdienstes spricht. Wir hören Lukas 13, die Verse 10 bis 17:
Jesus lehrte in einer Synogoge am Sabbat. Da war eine Frau, die war durch einen Geist seit achtzehn Jahren behindert. Sie war verkrümmt und unfähig, sich zur Vollkommenheit aufzurichten. Als er sie sah, rief Jesus sie herbei und sagte zu ihr: Frau, du bist von deiner Behinderung befreit. Und er legte ihr die Hände auf. Sogleich vermochte sie sich zur Vollkommenheit aufzurichten und lobte Gott.
Der Synagogenvorsteher aber war ungehalten darüber, daß Jesus diese Heilung am Sabbat vollzogen hatte und sagte zur Gemeinde: An sechs Tagen soll man arbeiten. An denen kommt, um euch heilen zu lassen, nicht aber am Sabbat! Der Herr entgegnete: Heuchler! Bindet ihr nicht alle euren Ochsen oder Esel von der Krippe, um ihn zur Tränke zu führen? Und diese Frau, eine Tochter Abrahams, die der Satan achtzehn Jahre lang gebunden hielt, mußte sie nicht am Sabbat von dieser Fessel erlöst werden?
Als er das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren, und die ganze Gemeinde freute sich über die herrlichen Dinge, die er tat.
Die Schriftlesung aus der Apostelgeschichte, über die wir miteinander nachdenken wollen, zeigt uns, wie die Auferstehungswirklichkeit in der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem zu handfester Lebenspraxis geführt hat. Wir hören aus Apostelgeschichte 2 die Verse 42 bis 47 :
Sie waren unentwegt bemüht um die Lehre der Apostel und die Gemeinschaft, ums Brotbrechen und die Gebete. Gottesfurcht erfasste alle: Viel Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle, die zum Glauben gekommen waren, hatten alles gemeinsam. Sie verkauften ihr Hab und Gut und teilten den Erlös unter alle, je nach den Bedürfnissen eines jeden. Einmütig gingen sie jeden Tag in den Tempel, sie brachen das Brot in den Häusern und aßen gemeinsam in Freude und Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren wohl gelitten bei allen. Und täglich führte der Herr Menschen zur Gemeinde, denen Heil widerfuhr.
Liebe Freunde,
schon oft hat mich die Frage der heimlichen Gottesdienste beschäftigt, die unsere Altvorderen gefeiert haben, nicht zuletzt in der « Baouma traouchada », einer Höhle hoch über dem Ibietal. Warum haben die Gläubigen damals ihre Freiheit aufs Spiel gesetzt und ihre Familie, ihr Leben in Gefahr gebracht, indem sie sich in dunkler Nacht an diese schwer zugänglichen Gottesdienstorte begaben? Warum sind sie nicht zu Hause geblieben, um allein oder in der Familie zu beten? Warum waren ihnen diese « Gottesdienste in der Wüste » so ungeheuer wichtig?
Diese Frage wird unausweichlich, wenn heute - und zumal im Herzen des Hugenottenlandes - vom evangelischen Gottesdienst die Rede ist. Denn unsere Vorfahren hatten ohne Zweifel begriffen, daß es einen qualitativen Unterschied gibt zwischen dem Gebet des einzelnen und dem Gottesdienst. Einen geistlichen Unterschied, der es verdient, immer wieder neu betont zu werden. Und er verdient es auch, daß man ihn erlebt, daß man ihm begegnet - in jedem Gottesdienst, den wir miteinander feiern.
Was ich im folgenden mit Euch teilen will, erhebt nicht den geringsten Anspruch auf Originalität. Es spiegelt lediglich einiges von dem, was mir bei meinen Besuchen unserer diesjährigen Kunstausstellung und den sie begleitendenden Texten von Professor Klaus Schwarzwäller durch den Kopf gegangen ist. Die beiden biblischen Texte, die wir gehört haben, scheinen mir sehr zentral von dem zu sprechen, was unseren Sonntagsgottesdienst prägt. Und es kann gut sein, daß das für manche unter uns so selbstverständlich ist, daß sie kaum darauf acht haben.
Ich bin dankbar dafür, immer wieder Leute zu treffen, die einen oder mehrere Gottesdienste mit uns feiern, und die dann überrascht sind: überrascht über die Herzlichkeit und Offenheit, die sie in unserer Gemeinde erleben, begeistert von den zahlreichen Kontakten, die sich oft spontan nach dem Gottesdienst ergeben, glücklich über die Brüderlichkeit, die bei uns herrscht und in die sie ganz selbstverständlich einbezogen werden. Für viele von uns ist das alles nicht der Rede wert - und so kann leicht vergessen werden, daß diese herzliche Gemeinschaft ein ganz wesentliches geistliches Gut ist. Das darf auf keinen Fall unterschätzt werden, es sollte im Gegenteil bewußt erlebt und gepflegt werden, vor allem, damit es nicht zu oberflächlicher Routine verkommt.
So ist es mir besonders wichtig, daß wir heute über Grundlinien christlichen Gemeindelebens nachdenken können.
Die Apostelgeschichte berichtet uns, daß die ersten Christen unentwegt gemeinsam bemüht waren um die Lehre der Apostel und die brüderliche Gemeinschaft, um das Brotbrechen und die Gebete.
Vier Grundwerte christlichen Lebens sind hier genannt. Und es ist nicht von ungefähr, daß die Lehre der Apostel an erster Stelle steht. Damals, in der Zeit des ersten Aufschwungs und des dynamischen Wachstums der Gemeinde wußte man (vielleicht klarer als heute), daß das gemeinsame Leben und seine innere Kraft erlahmen können, wenn es nicht immer wieder neu ausgerichtet wird auf und durch die Lehre der Apostel. Erstes Anliegen und wichtigste Aufgabe jeglicher Christengemeinde ist darum das immer wieder mutig unternommene « Zurück zu den Quellen », zum Wort Gottes, das uns durch die Alten überkommen ist. Nur dadurch werden wir das Wesentliche wahrzunehmen fähig sein. Nur dadurch werden wir zu einem echten und überzeugenden Glaubenszeugnis finden.
Allerdings ist das Leben der Kirche nicht allein auf « Lehre » gegründet (also auf Intellektuelles). Das ist wichtig, sogar unerläßlich. Aber das ist nicht alles. Darum redet die Apostelgeschichte an zweiter Stelle von der brüderlichen Gemeinschaft. Im Zusammenhang mit dem Gottesdienst ist hier sehr wesentlich an die Liturgie zu denken. Genau übersetzt, heißt dieses Wort « was die Gemeinde tut ». Für mich ist das ein wesentliches Element des gemeinsamen Feierns. Die gesungenen Antwortverse, die Choräle sind uns geläufig und verbinden uns, sie erwachsen aus der geistlichen Dynamik, die uns zusammenführt und uns gemeinsam unterwegs bleiben läßt.
Und dann ist « das Brotbrechen » genannt. Natürlich wissen Sie, daß der Apostel damit das Abendmahl meint. Aber wie so oft beim Bibellesen, ist es gar nicht gut, wenn man immer schon alles weiß. Denn dieser Ausdruck als solcher kann uns eine ganze Menge über das Abendmahl erkennbar machen, das ja für viele unter uns noch nicht das Drohende, Erschreckende verloren hat, mit dem es für viele Menschen noch in gar nicht ferner Vergangenheit verbunden war. Erst heute wird wieder entdeckt, warum der älteste Begriff für das Abendmahl ausgerechnet « Eucharistie » heißt: Große, überschäumende Freude und Dankbarkeit heißt das. Und für die ersten Christen war das gemeinsame Mahl in der Tat ein Augenblick ganz großer Freude. Der Ausdruck « Brotbrechen », den wir hier vor uns haben, läßt eine Geste aufleuchten, die Sie jetzt gleich erleben werden und die mir ganz besonders wichtig ist: Denn nicht allein das Abendmahl läßt sich mit diesem Begriff bezeichnen. Zur Zeit der ersten Christen bezeichnete er im Grunde jedes gemeinsame Mahl. Der Familienvater pflegte vor Beginn des Essens einen Brotfladen zu nehmen und ihn mit einem Gebet, einem Segenswort zu segnen, das heute noch jedes jüdische Kind auswendig kann: « Herr, König der Welt, wir segnen dich, denn du läßt das Brot aus der Erde wachsen ». Dann wurde der Fladen in Stücke gebrochen und alle, die zum Mahl versammelt waren, bekamen davon. So wurde die Gemeinschaft des Mahls gekennzeichnet - ganz konkret und zugleich ganz spirituell -, bevor man sich den Freuden des Tisches hingab, den Gaumenfreuden und auch denen des Herzens, die zu einem wirklich guten gemeinsamen Essen gehören...
In den Anfängen erlebte man christliche Gemeinschaft wie das Eingebundensein in eine große Familie. Man kam abends zur Hauptmahlzeit zusammen, zu einem besonderen Moment der Gemeinschaft, der es erlaubte, beieinander zu sein, sich aufs Laufende zu bringen, aber auch, geistlich wieder aufzutanken. Können Sie sich vorstellen, welche sehr handfesten Auswirkungen eine solche Lebenspraxis hatte?
Können Sie verstehen, daß sehr viele Menschen da hinzugehören wollten, zu diesem Kreis von Menschen, in dem man sich zu Hause fühlen konnte, wo man sich aufgenommen und verstanden und begleitet wußte, wo jeder seinen Platz und seine Würde fand, und Weggenossen, auf die man sich verlassen konnte. Und das gemeinsame Essen war ein gottesdienstliches Ereignis!
So ist es auch nicht verwunderlich, daß das vierte Element dieses « musterhaften » Gemeindelebens die Gebete waren. Wundern Sie sich nicht über die Mehrzahl. Die Gebete (in der Mehrzahl) erinnern daran, daß es ja nicht DAS Gebet gibt, sondern eine Vielzahl von Weisen, zu beten: Da kommt man, selbst wenn man sich sehr in diesen Lebensbereich vertieft, nie zum Ende und macht immer neue Entdeckungen. Leider spricht man von dieser Erfahrungswirklichkeit viel zu wenig, jedenfalls unter uns Reformierten.
Natürlich gibt es eine Form des persönlichen, sehr individuellen Gebets, das in einem Maße « privat » (das heißt auf deutsch: den anderen vorenthalten!) ist, daß man es mit niemand teilen kann. Und wenn ich hier « privat » sage, dann ist es nicht ganz verkehrt, wenn Sie einen kritischen Unterton heraushören.Freilich hat die sehr persönliche Beziehung zu unserem Gott, der uns liebt, ihr Recht und darf auch Platz haben in unserem Leben - aber es heißt für mein Erachten die berühmte reformierte Schamhaftigkeit übertreiben, wenn man das gemeinsame Gebet völlig aus den Augen und Gewohnheiten verliert...
Wir dürfen nicht vergessen, daß das gemeinsame Gebet schon im Evangelium mit einer besonderen Verheißung verbunden ist: « Wenn zwei unter euch eins werden, um zu erbeten, was immer sie wollen, das soll ihnen von meinem Vater im Himmel zuteil werden. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen! » (Mt 18)
Diese besondere Verheißung darf nicht verloren gehen! Sie erinnert mich an die verkrümmte Frau aus dem heutigen Evangelium, die 18 Jahre lang unfähig war, sich « zur Vollkommenheit aufzurichten » - und ausgerechnet im Gemeindegottesdienst wird sie von Jesus so bewegend berührt, daß wieder Gott zu loben fähig wird!
Zum Schluß möchte ich mit euch eine überraschende kleine geistliche Entdeckung teilen, die rein zufällig das resümiert, was ich mit Ihnen teilen wollte:
Der Rabbi Jehuda Hanassi fragte eines Tages seine drei bevorzugten Schüler, welches ihrer Meinung nach die wichtigste Lehre der ganzen Tora sei, die alle anderen in sich enthalte.
Ben Soma sagte: Das « Schema Jisrael », das Glaubensbekenntnis aller Juden. Rabbi Juda sagte nichts. Ben Assai antwortete: Das « Weahafta », das Martin Buber übersetzt hat mit « Liebe deinen Nächsten, er ist wie du! ». Rabbi Juda sagte wieder nichts.
Schließlich zitierte der am wenigsten bekannte Schüler, Ben Pasi, ein Wort aus dem 4.Buch Mose (28,3): Jeden Tag sollst du am Morgen und am Abend ein Lamm opfern! Und diesem Zitat stimmte Rabbi Jehuda zu. Denn in der Tat: Das « Schema Jisrael » ist nur ein konzentrierter Lehrsatz, den jeder für sich zitiert. Das Nächstenliebegebot: Ein unerhört hoher ethischer Anspruch, dem im Grunde kein Mensch voll und ganz gerecht werden kann. Und der Aufruf, am täglichen Opfer teilzunehmen? Richtig, das ist genau das, was die ersten Christen miteinander verbunden hat, in der Teilnahme am Tempelgottesdienst und im gemeinsamen Mahl. Und der Gottesdienst, der uns am Sonntag zusammenführt, will uns alle mit derjenigen Kraft des Geistes erfüllen, die es möglich macht, daß wir unseren Glauben bekennen und zur Nächstenliebe fähig werden. Amen.
Himmlischer Vater, du hast uns nicht nur deinen Sohn gegeben,
der unsere menschliche Bedingtheit mit uns geteilt hat,
du schenkst uns auch Weggenossen und geschwisterliche Gemeinschaft
mit all denen, die du wie uns berufen hast, damit sie uns nahe seien auf dem Weg des Glaubens.
Wir danken dir für diese Gemeinsamkeit des Glaubens und der Dankbarkeit, und wir bitten dich heute ganz besonders, daß diese brüderliche Gemeinschaft, die uns trägt, in deiner Kirche immer wieder neu Wirklichkeit werde.
Du hast deine Kirche berufen, daß sie der lebendige Leib deines auferstandenen Sohnes sei in der Welt. Du willst die Kirche als lebendigen, handlungsbereiten Organismus, der deinen Willen vollzieht, deine Liebe, deine Gebote.
Sie ist der lebendige Leib, der in Tat und Wahrheit, in Liebe und Gerechtigkeit,
im Einsatz für Freiheit und Menschenwürde aller Menschen wirksam ist -
und das ganz besonders für die, die verfolgt und verfemt, ausgegrenzt und des Landes verwiesen werden, auch für die, die gefoltert und bedroht sind,
kurz: für alle, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.
Gib deiner Kirche überall in der Welt, daß sie sich zu deinem Lob versammelt, daß sie auf dein Wort hört, um dann präsent zu sein dort, wo man spürbare Zeichen Deiner Nähe erwartet, wo deine Gerechtigkeit ersehnt wird und deine Zärtlichkeit, wo dein Geist der Versöhnung gebraucht wird, der Einheit schafft und Ermutigung, Vergebung und neue Lebensperspektiven.
Laß die Kirche deinem Aufruf folgen, der immer wieder neu an sie ergeht.
Denn du allein kannst schenken, daß unsere Liebe ohne Eigennutz sei und unser Zeugnis echt und ungekünstelt, daß unsere geschwisterliche Gemeinschaft offen bleibt für alle, die dich suchen - damit sie auf den Weg des Glaubens finden.
Schenke uns, Herr, deinen Geist - den Geist, der die Herzen prüft, der Demut und Reue möglich macht - und der zugleich verhindert, daß wir dort blind vorübergehen, wo du uns gerade dem Menschenkind begegnen lassen willst, für das wir Bruder oder Schwester werden dürfen, im gemeinsamen Hören und Beten, und in der Gemeinsamkeit unter deinem Segen.